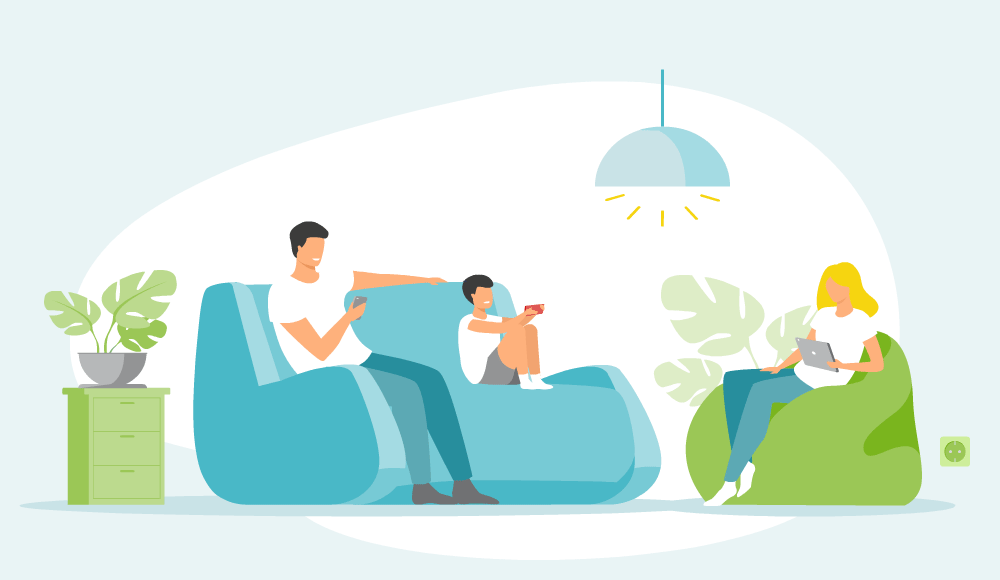Auf dem Laufenden bleiben
Newsletter
Melden Sie sich zu unserem Newsletter an und lesen Sie Neuigkeiten zum ok-power-Siegel, zu Projekten unserer Anbieter sowie zum Ökostrommarkt. Versand ca. dreimal im Jahr.
Schon mal reinlesen? Hier finden Sie die letzten zwei Ausgaben unseres Newsletters.
Ökostrom FAQ
Sie haben Fragen zum Thema Ökostrom, zum ok-power-Siegel oder zur Zertifizierung? Sollten Sie hier nicht die passende Antwort finden, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.

- Am wichtigsten ist, dass die Ökostromanbieter die Energiewende zusätzlich fördern. Bei Ökostromprodukten mit ok-power-Siegel erfolgt dies im Zuge der Zertifizierung über verschiedene, modular anwendbare Wahlpflichtkriterien mit jeweils eigenen Fördermechanismen. Nähere Informationen finden Sie hier.
- Die Frage nach der Verflechtung des Ökostromanbieters mit Atom- und Kohlekraftwerksbetreibern ist ein weiterer Punkt für glaubwürdige Ökostromprodukte. ok-power zeichnet keine Ökostromanbieter aus, die selbst an Atom-, Braunkohle- oder neuen Steinkohlekraftwerken beteiligt sind. Ebenfalls nicht zertifiziert werden Anbieter, die mindestens zu 50 % im Eigentum von Atom- oder Braunkohlekraftwerksbetreibern sind.
- Faire Tarifbedingungen spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit. ok-power hat dieses Kriterium sogar als Pflichtkriterium definiert, ohne dessen Erfüllung kein Anbieter das ok-power-Siegel in Anspruch nehmen kann.
Nicht unbedingt. Der Markt ist sehr dynamisch und viele zertifizierte Ökostromprodukte sind mittlerweile preislich auf Augenhöhe, manchmal sogar günstiger als alternative Angebote. Durch den Anbieterwechsel zu einem ok-power-zertifizierten Tarif können Sie die Energiewende aktiv unterstützen – oft ohne Mehrkosten.
Jeder Stromverbraucher (privat wie gewerblich) hat das Recht, von einem Versorger seiner Wahl den Strom zu beziehen. Egal, ob er zur Miete oder im Wohneigentum wohnt.
Wählen Sie z. B. im ok-power-Tarifportal einen Tarif bzw. Anbieter, zu dem Sie wechseln möchten und füllen Sie das Formular für einen Liefervertrag aus. Alle Anbieter im ok-power-Tarifportal haben verbraucherfreundliche Tarifbedingungen.
Nach Erhalt Ihres Antrags wird der von Ihnen gewählte Anbieter das Zustandekommen des Liefervertrages bestätigen und alles Weitere für Sie veranlassen. Auch die Abmeldung beim bisherigen Versorger übernimmt er für Sie. In der Regel beginnt die Versorgung des neuen Anbieters zum nächsten oder übernächsten Monatsanfang. Sie erhalten nach Versorgungsbeginn eine Schlussrechnung des bisherigen Versorgers. Weitere Informationen finden Sie unter dem Punkt „Anbieter wechseln“.
Nein. Die gesetzliche Versorgungspflicht gewährleistet, dass die Stromversorgung immer reibungslos funktioniert. Sollte der neue Versorger aus irgendwelchen Gründen ausfallen, erfolgt automatisch die nahtlose Belieferung durch den örtlichen Grundversorger. Verbraucher:innen zahlen dann zwar den meist teureren Grundversorgungstarif, können aber jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen zu einem anderen Stromversorger wechseln.
Selbstverständlich können Sie auch zu einem Ökostrom-Anbieter wechseln, wenn Sie mit Strom heizen. Allerdings: Für gewöhnlich haben Nachtstrom-Kunden einen besonders günstigen Sondertarif bei ihrem lokalen Grundversorger. Obwohl seit 2011 auch andere Versorger günstigeren Nachtstrom liefern dürfen, sind alternative Anbieter bisher noch kaum auf dem Markt. Sie können jedoch zumindest den Anbieter für die Belieferung mit Haushaltsstrom wechseln und den Heizstrom weiter vom bisherigen Versorger beziehen. Meist ist die Voraussetzung dafür, dass Heiz- und Haushaltsstrom mit zwei unabhängigen Zählern gemessen werden.
Bei der Stromversorgung muss zwischen der physikalischen und der „kaufmännischen“ Versorgung unterschieden werden. Physikalisch ist Elektrizität gleichartig, egal, ob sie aus einem Windpark oder einem Kohlekraftwerk stammt. Entnimmt man dem Stromnetz Strom, so wird er gemäß den physikalischen Gesetzen immer aus der nächstgelegenen Erzeugung bzw. dem nächstgelegenen Umspannwerk bereitgestellt (Weg des geringsten Widerstandes). Diese physikalische Eigenheit wird beim Handel des Stromes jedoch abstrahiert. Strommengen können unabhängig von ihrem tatsächlichen Fluss gekauft und verkauft werden. Deshalb können Kund:innen den Stromanbieter wechseln. Dieser muss die zu liefernde Menge viertelstundengenau ins Stromnetz einspeisen und in sogenannten Bilanzkreisen, einem Kontensystem für Strommengen, nachweisen. Entscheidend beim Ökostrombezug ist nun die Frage, aus welchen Kraftwerken der Ökostromlieferant seinen zu liefernden Strom kauft.
„Ein Herkunftsnachweis besagt, dass eine Megawattstunde (MWh) Strom aus einer Anlage, die erneuerbare Energie erzeugt, ins Stromnetz eingespeist wurde. Also: Der Herkunftsnachweis sagt, dass Strom aus erneuerbaren Energien stammt.“ (Umweltbundesamt)
Ein Ökostromsiegel wie ok-power ist ein Qualitätssiegel für das gesamte Ökostromprodukt. Es nutzt Herkunftsnachweise als Verifikation der Herkunft des Stroms und fordert vom Anbieter weitere Qualitätskriterien, die jenseits von Herkunftsnachweisen nachgewiesen werden müssen. Kurzum: hochwertige Ökostrom-Siegel garantieren einen ökologischen Mehrwert, der über den reinen Bezug aus erneuerbaren Quellen hinausgeht, wie z. B. der Bezug aus neuen Anlagen, so dass ein kontinuierlicher Neubau von Anlagen zur erneuerbaren Stromerzeugung erfolgt. Oder sie bescheinigen ein besonderes Engagement des Anbieters bei der Transformation des Energiesystems und der Energieeffizienz.
ok-power ist die Glaubwürdigkeit der Ökostromtarife essenziell wichtig. Wir möchten daher im Folgenden erläutern, warum die sogenannte Kopplung von HKN kein sinnvolles Bewertungskriterium für die Glaubwürdigkeit eines Ökostrom-Produktes darstellt und daher auch ausdrücklich kein Bestandteil der ok-power-Kriterien ist:
Eine Kopplung der HKN an eine „physische Liefer
ung“ oder einen „Direktbezug aus einem bestimmten erneuerbaren Kraftwerk“ bewirkt keinen zusätzlichen Beitrag zur Energiewende. Bei der praktischen Bilanzierung der Strommengen bleibt dieses Verfahren der Kopplung eine Abstraktion, da der Strom physikalisch keine grüne Eigenschaft aufweisen kann. Der Verbrauch von Strom wird aufgrund der physikalischen Gesetze stets vom nächstliegenden Kraftwerk bzw. Transformator bereitgestellt. Wir sehen sogar ein erhebliches Glaubwürdigkeitsrisiko, wenn bei Verbrauchern mit der Kopplung die Vorstellung einer physikalischen Lieferung vom Kraftwerk zu ihrem Stromanschluss geweckt wird. Bezieht ein Anbieter seine mit einer Stromlieferung gekoppelten HKN aus einem bestimmten Wasserkraftwerk, z.B. aus Österreich, so fließt dieser Strom nicht von diesem Wasserkraftwerk physikalisch nach z.B. Norddeutschland und schon gar nicht direkt zu den jeweiligen Kunden.
Gemeint ist in der Diskussion vielmehr eine „kaufmännische“ oder „bilanzielle“ Kopplung, die mengengleich oder zeitgleich erfolgen kann. Dabei wird der beschaffte Strom einem oder mehreren bestimmten Kraftwerken zugeordnet. Auch diese bilanzielle Zuordnung von Mengen bewirkt keinen ökologischen Nutzen. Häufig wird die Kopplung so beschrieben, dass im Liefervertrag ein Kraftwerk genannt wird und die Zahlungsflüsse an den Betreiber dieser Kraftwerke fließen. Der Nachweis, dass der gekaufte Strom aus den vertraglichen vereinbarten Kraftwerken stammt, wird jedoch auch nur über Herkunftsnachweise geleistet. Es dürfte kein Großhändler für erneuerbare Energien ohne einen gewissen Ausgleich seines Portfolios und seiner Bilanzkreise mit Strombeschaffung aus unbekannter Herkunft auskommen. Deshalb macht es Sinn, im Strommarkt den Handel von Strom vom Handel mit dessen Herkunft getrennt zu betreiben.
Das ist nur sehr schwer möglich. Es gibt einen sehr großen Aufklärungsbedarf hinsichtlich der Verfahren zum Nachweis einer gekoppelten Lieferung. Ein Nachweisverfahren für eine Kopplung bietet z. B. das Herkunftsnachweisregister des Umweltbundesamtes an. Es wird aber von den Ökostromanbietern kaum genutzt, da es offenbar keine Kopplung von Lieferungen aus dem Ausland abbilden kann. Mit dem Label EE02 des TÜV Süd werden z. B. Nachweise einer zeitgleichen Lieferung aus definierten Kraftwerken angeboten, worauf einige wenige Anbieter Wert legen. Viele andere Anbieter sprechen bei „Kopplung“ davon, dass sie Kraftwerke in den Lieferverträgen definieren würden. Dies ist aber noch kein Nachweis der Kopplung an sich. Eine weiterhin häufig vorgebrachte Formulierung lautet, dass Lieferverträge „direkt mit dem Lieferkraftwerken“ abgeschlossen würden. Das erscheint angesichts der Praxis des Stromhandels kaum plausibel, da Kraftwerke in der Regel von übergeordneten Trading-Gesellschaften vermarktet werden.
Vor dem Hintergrund dieser diffusen Informationslage halten wir eine Zertifizierung einer „physikalischen“ Beschaffungskette, die völlig frei von direkten oder indirekten Beziehungen zur Strombörse sein soll, für methodisch nicht möglich. Unabhängig davon halten wir sie für die Aussage, ob ein Ökostromprodukt glaubwürdig ist oder nicht, für irrelevant.
Jeder Anbieter muss sämtliche Pflichtkriterein erfüllen. Bei den Wahlpflichtkriterein gibt es kein „besser“ oder „schlechter“, da sie schwer vergleichbar sind, alle jedoch einen zusätzlichen Beitrag zur Energiewende leisten. Sämtliche Kriterien sind – einzeln oder in Kombination – so konzipiert, dass sie einen etwa gleichwertigen Nutzen für die Umwelt bringen sollen. Wenn Sie also ein Ökostromprodukt mit ok-power-Gütesiegel beziehen, können Sie sicher sein, dass davon die Umwelt profitiert. Die Energiewende-Expert:innen im Kriterienbeirat von ok-power überprüfen jedes Jahr aufs Neue, ob der Kriterienkatalog angepasst werden muss, um denselben Umwelteffekt zu erzielen – beispielsweise wegen Gesetzesänderungen oder aktuellen Marktentwicklungen. Wenn Sie wissen möchten, nach welchen Kriterien Ihr Ökostrom-Produkt zertifiziert ist, können Sie dies auf der Seite „Zertifizierte Anbieter“ nachsehen.
Bei der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) werden Strom und Wärme gleichzeitig erzeugt. So lässt sich die Energie besser ausnutzen. Mit KWK lassen sich ganz verschiedene Kraftwerkstypen betreiben – die meisten davon haben jedoch mit Erdgas einen fossilen Energieträger als Grundlage, weshalb sie nicht zu den erneuerbaren Energien gezählt werden können. Dennoch sind KWK-Anlagen ein wichtiger Baustein für den schnellen Wechsel hin zu einer CO2-armen Energieversorgung.
Lexikon: Begriffe rund um Energie und Ökostrom
Einfach gesagt, bedeutet Energiewende den Übergang von einer atomaren und fossilen Energieerzeugung hin zu einer Versorgung aus regenerativen Quellen. Deutschland ist mittendrin in diesem ambitionierten Prozess, der von Investitionen lebt und ohne das Engagement der Verbraucher:innen wie auch der Energieversorger nicht gelingen kann.
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist ein Instrument zur Förderung und zum Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland. Seit seinem Inkrafttreten im Jahr 2000 wurde das Gesetz mehrfach novelliert und an den Markt angepasst.
Kernelemente sind zum einen die bevorzugte Einspeisung von regenerativ erzeugtem Strom ins Stromnetz. Das bedeutet, dass die Netzbetreiber verpflichtet sind, EEG-Anlagen ans Netz anzuschließen, die dort erzeugte Energie abzunehmen und vorrangig gegenüber Strom aus fossilen Quellen einzuspeisen.
Zum anderen garantiert das EEG den Betreibern, je nach Anlagengröße und Vermarktungsmodell, feste Vergütungssätze oder eine Marktprämie für den eingespeisten Strom. Auf diese Weise soll ein wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen ermöglicht und gleichzeitig der Markt für erneuerbare Energien wettbewerbsfähig gemacht werden.
Die EEG-Beihilfengenehmigung der EU läuft zum Ende des Jahres 2026 aus. Zudem führt der neue Artikel 19d der Elektrizitätsbinnenmarktverordnung eine Rückzahlungsverpflichtung ab Mitte 2027 ein. Dies war eine Konsequenz aus der Debatte um sogenannte Zufallsgewinne während der Energiepreiskrise. Aus diesem Grund ist eine Neuausrichtung des EEG-Fördersystems erforderlich. Zukünftig wird die Förderung von Neuanlagen nur per zweiseitigem Differenzvertrag (CfD) oder gleichwertigem System mit denselben Auswirkungen erfolgen können. Dabei können Mindestvergütungen weiterhin garantiert, aber gleichzeitig Erlöse gedeckelt werden.
Der Stromanbieter, der innerhalb eines Netzgebietes die meisten Haushaltskunden mit Strom versorgt, gilt als Grundversorger. Er wird alle drei Jahre vom jeweiligen Netzbetreiber neu bestimmt. Grundversorgern kommt eine spezielle Verantwortung zu: Sie stehen in der Pflicht, jeden Haushaltskunden in ihrem Netzgebiet, der dies wünscht, mit Energie zu versorgen.
Bei Insolvenz eines Stromversorgers fallen dessen Kunden automatisch in die Grundversorgung. Dadurch stellt der Grundversorger jederzeit eine unterbrechungsfreie Energielieferung sicher. Den Stromkunden steht es dann frei, erneut einen neuen Stromversorger zu wählen.
Möchte ein Stromanbieter an seine Kundeninnen und Kunden Ökostrom verkaufen, muss er sogenannte Herkunftsnachweise beschaffen. Dahinter steht das Grundprinzip, dass der physische Strom unabhängig vom bilanziellen Strom ist. Kauft ein Anbieter beispielsweise an der Strombörse ein, so ist nicht nachvollziehbar, aus welchen Quellen der Strom stammt (Graustrom). Das Versorgungsunternehmen kann nun aber zusätzlich Herkunftsnachweise einkaufen, um seinen Strom als Ökostrom vermarkten zu dürfen.
Für jede produzierte Gigawattstunde Ökostrom gibt es einen Herkunftsnachweis. Die Nachweise werden europaweit gehandelt. Das Energieversorgungsunternehmen muss die gekauften Herkunftsnachweise im Herkunftsnachweisregister des Umweltbundesamtes entwerten lassen, um seinen Strom als Ökostrom verkaufen zu dürfen. Damit ist abgesichert, dass die grüne Qualität von Ökostrom nur einmal an einen Kunden oder eine Kundin verkauft wird. Anlagen, die nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz gefördert werden, bekommen keine Herkunftsnachweise ausgestellt, da sonst eine doppelte Förderung bestände (Doppelvermarktungsverbot).
Herkunftsnachweise garantieren allerdings nicht automatisch einen ökologischen Nutzen. Häufig werden die Nachweise bei deutschen Stromanbietern aus Norwegen von Wasserkraftwerken beschafft. Die Anlagen sind allerdings bereits seit Jahrzehnten im Betrieb und durch den Kauf der Nachweise werden nicht automatisch neue Anlagen gebaut. Dadurch werden die Nachweise lediglich zwischen den Markteilnehmern hin und her getauscht. Wer sicher gehen will, dass sein Ökostrom auch zu einem Ausbau der erneuerbaren Energien führt, sollte auf Ökostrom-Gütesiegel wie das ok-power-Siegel achten.
Ökostrom stammt formal aus erneuerbaren Energien – häufig werden aber lediglich Herkunftsnachweise aus bestehenden Anlagen eingekauft. Um die Energiewende voranzutreiben, müssen jedoch mehr Anlagen gebaut und so fossiler Strom aus Atom- und Kohlekraft vom Markt verdrängt werden. Hochwertiger Ökostrom leistet einen messbaren Beitrag zum angestrebten Umbau unseres Energiesystems, indem der Ausbau erneuerbarer Energien und deren Integration ins Versorgungssystem über die gesetzlichen Rahmenbedingungen hinaus gefördert werden.
Das ok-power-Siegel kennzeichnet Angebote, die diesen positiven Beitrag leisten. Eine Übersicht zertifizierter Tarife finden Sie in unserem unabhängigen Tarifportal.
Der Kohleausstieg beschreibt die Beendigung der Verbrennung von Stein- und Braunkohle für die Energieerzeugung. Als Alternative sollen in Zukunft vornehmlich erneuerbare Energien den Strom in Deutschland produzieren. Durch den Ausstieg werden zahlreiche Schäden an Mensch und Natur vermieden. Zur konzeptuellen Ausgestaltung des Ausstiegs wurde 2018 von der Bundesregierung die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ eingesetzt, die 2019 ihren Abschlussbericht vorlegte. Nach zahlreichen Debatten und Anpassungen verabschiedeten Bundestag und Bundesrat im Juli 2020 das Kohleausstiegsgesetz, das eine schrittweise Beendigung der Kohleverstromung bis spätestens 2038 vorsieht. Klimaschützer kritisieren diesen Fahrplan scharf, da damit die Klimaziele, wie sie etwa das Pariser Abkommen vorsieht, nicht mehr zu erreichen sein werden.
Unter einem Power Purchase Agreement, kurz PPA, versteht man einen langfristigen Stromliefervertrag, der direkt zwischen einem Stromabnehmer und einem Stromproduzenten abgeschlossen wird. Darin werden die individuell zwischen beiden Seiten ausgehandelten Konditionen wie gelieferte Menge, Preise und Laufzeiten festgeschrieben. PPAs bieten insbesondere großen Stromabnehmern die Möglichkeit, Marktpreisrisiken zu reduzieren. Zudem können durch PPAs Erneuerbare-Erzeugungsanlagen unabhängig von staatlichen Förderungen realisiert bzw. ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb nach Ablauf des gesetzlichen Förderzeitraums ermöglicht werden. Seit 2023 finden PPAs auch in den ok-power-Kriterien Berücksichtigung.
Seit Anfang 2019 können Stromanbieter ihren Kunden Regionalstromprodukte aus EEG-Strom anbieten. Dazu werden Regionalnachweise ausgestellt, aus denen hervorgeht, in welcher EEG-Anlage eine bestimmte Menge Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wurde. Die Stromkundin oder der Stromkunde erhält damit die Garantie, dass sich die Anlage, aus der „sein“ Strom stammt, im Umkreis von 50 Kilometern befindet. Verwaltet werden die Regionalnachweise im Regionalnachweisregister (RNR) des Umweltbundesamtes. Das System stellt sicher, dass die regionale Eigenschaft einer aus erneuerbaren Energien erzeugten Kilowattstunde Strom nur einmal an einen Verbraucher verkauft wird.
Repowering bezeichnet die Erneuerung alter Stromerzeugungsanlagen. Dieses Vorgehen ist meist kostengünstiger als ein Neubau an einem anderen Standort, der u. a. diverse Genehmigungsverfahren voraussetzt. Häufige Anwendung findet das Verfahren in der Windindustrie. Beispielsweise werden Rotorblätter durch die technologische Weiterentwicklung immer größer und effizienter. So können in einem Windpark viele kleine Anlagen gegen weniger größere Anlagen ausgetauscht werden.
Sektorenkopplung beschreibt die Zusammenführung bzw. Vernetzung des Energiesektors mit den Bereichen Industrie und Verkehr in einem ganzheitlichen Ansatz. Durch die Betrachtung als Gesamtsystem werden Aspekte wie eine Steigerung der Energieeffizienz sowie die flexible Speicherung von Energie ermöglicht und gefördert. Entscheidend ist dabei die konsequente Nutzung von erneuerbaren Energien statt fossiler Brennstoffe. Dann kann die Sektorenkopplung ein Schlüsselkonzept für die Dekarbonisierung der Energieerzeugung und des Energieverbrauchs und somit auch der Energiewende sein.
Die Strombörse ist der Handelsplatz, an dem Anlagenbetreiber ihren Strom verkaufen und Anbieter oder Verbraucher (z. B. große Industriebetriebe) Strommengen kaufen können. Eine der größten Börsen für Energie ist die EEX in Leipzig. Alle Strommengen, die hier gehandelt werden, verlieren ihre Herkunftseigenschaften und werden als so genannter Graustrom gehandelt. D.h. dass nicht mehr nachvollziehbar ist, ob der Strom aus Atomkraftwerken oder Windkraftanlagen stammt. Möchte ein Stromanbieter explizit Ökostrom verkaufen, muss er zusätzlich Herkunftsnachweise erwerben.
Strom aus erneuerbaren Energien, der in Deutschland durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz gefördert wurde, darf aufgrund des Doppelvermarktungsverbots nicht als Ökostrom weiterverkauft werden. Diese Mengen werden ebenfalls an der Strombörse gehandelt.
Da alle an der Börse vermarkteten Strommengen zu Graustrom werden, gibt es nur einen Preis für eine Kilowattstunde Strom. Dieser Preis ist von verschiedenen Faktoren wie den benötigten Strommengen abhängig. Innerhalb eines Tages kann sich der Strompreis bis zu 100 Mal ändern.
Die Stromkennzeichnung visualisiert, aus welchen Quellen der Strom stammt, den ein Stromanbieter an seine Kundinnen und Kunden verkauft hat. Dies wird häufig in einem Kreisdiagramm dargestellt. Die Verteilung zwischen den Stromquellen wird auch Strommix genannt. Neben den Stromquellen zeigt die Grafik auch den Anteil, den das Unternehmen an EEG-Umlage zahlt, sowie die Menge an CO2 und Atommüll, die das Unternehmen produziert.
Die Form der Stromkennzeichnung ist gesetzlich geregelt. Sie steht allerdings auch in der Kritik, da durch den Anteil an gezahlter EEG-Umlage (erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage) der Anschein entsteht, das Unternehmen habe einen großen Anteil an Erneuerbaren im Angebot. Tatsächlich verbirgt sich aber nur hinter dem Anteil „Sonstige Erneuerbare Energien“ Strom, der vom Energieversorger verkauft wurde. Um den wirklichen Strommix des Versorgers zu erhalten, müsste der Anteil „Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage“ aus dem Kreisdiagramm herausgerechnet werden.
Dem Strom, der aus der Steckdose fließt, sieht man seine Herkunft nicht an. Und doch gibt es gerade beim Ökostrom Qualitätsunterschiede, insbesondere hinsichtlich seines Beitrags zum Ausbau erneuerbarer Energien und zur Energiewende. Zertifizierungen ermöglichen eine Nachvollziehbarkeit der Stromherkunft. Am entsprechenden Zertifikat oder Gütesiegel kann die Verbraucherin oder der Verbraucher die geprüfte Qualität erkennen.
Je nachdem, welches Zertifikat oder Gütesiegel angestrebt wird, müssen die Anbieter nachweisen, dass sie die dahinterstehenden Kriterien erfüllen. Diese können sich sowohl auf die Herkunft des Stroms als auch auf Beteiligungs- und Geschäftsmodelle des Anbieters beziehen. Gütesiegel wie ok-power fordern zudem bestimmte Standards im Hinblick auf den Verbraucherschutz.
Downloads
Hier finden Sie folgende Dokumente und Dateien zum Download:
ok-power-Zertifizierung und Kriterien
Tätigkeitsberichte
Studien
Hier haben Sie die Möglichkeit, Studien zum Thema Ökostrom herunterzuladen.
Ein neues Strommarktdesign für Deutschland
Freiburg, Juli 2024
Die für Deutschlands Klimaneutralität unerlässliche Dekarbonisierung des Stromsystems erfordert Anpassungen im Strommarktdesign. Darin gilt es, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um fossile Stromerzeuger vollständig durch erneuerbare Energien zu ersetzen. In einer aktuellen Studie im Auftrag des EnergieVision e.V. gibt das Öko-Institut einen umfassenden Überblick über die Herausforderungen und Lösungsoptionen, welche sich für das heutige Strommarktdesign im Zuge der Transformation der Stromsystems in Deutschland ergeben.
Mit dieser Übersicht möchte EnergieVision zur allgemeinen Diskussion über Ausgestaltungsoptionen des zukünftigen Marktdesigns beitragen. Im Speziellen soll die Studie als Grundlage dienen, um die Rolle von Ökostrom-Zertifizierung in einem neuen Marktdesign zu beleuchten: Wie können zertifizierte Ökostromangebote die notwendigen Entwicklungen möglichst gut unterstützen?
Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Deutschland
Freiburg, April 2024
Die vom EnergieVision e.V. co-finanzierte Studie des Öko-Instituts gibt einen Überblick über die Entwicklung, Potenziale und Herausforderungen von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Deutschland insgesamt. Finanzierungsmöglichkeiten für PV-Anlagen sind angesichts sinkender Modulpreise und der dynamischen Marktentwicklung ein weiterer Fokus der Überblicksstudie.
Ökostrom in der batteriebetriebenen Elektromobilität: Auswirkungen auf die Ökostrom-Zertifizierung
Freiburg, Januar 2024
Die batteriebetriebene Elektromobilität im motorisierten Individualverkehr wird in der kommenden Dekade deutlich zunehmen und am Ende in einer nahezu kompletten Umstellung von Verbrennungs- auf Elektroantriebe münden. Im Auftrag des EnergieVision e.V. hat sich das Hamburg Institut mit der Frage befasst, welche Herausforderungen und Chancen sowie praktische Konsequenzen sich aus dieser Entwicklung für die Zertifizierung von Ökostrom ergeben.
Im Rahmen der Analyse wurden Auswirkungen der batteriebetrieben E-Mobilität auf die Nachweisführung der Qualität und die Zertifizierung von Ökostrom an Ladepunkten vor dem Hintergrund der regulatorischen Kulisse untersucht. Darauf aufbauend wurden Empfehlungen für EnergieVision e.V. zum weiteren Umgang mit dem Thema in der Ökostromzertifizierung formuliert.
Diskussionspapier: Echter Einfluss für Ökostromverbraucher
Freiburg, Oktober 2020
“Harte Zusätzlichkeit” in Märkten für erneuerbare Energie über die bestehenden politischen Ausbauziele hinaus
Hier finden Sie die Deutsche Zusammenfassung des Diskussionspapiers für den EnergieVision e.V.
Eine ausführlichere Langfassung dieses Diskussionspapiers inkl. einer Zusammenstellung der relevanten Rechtstexte ist hier in englischer Sprache verfügbar.
Stellungnahme: Für eine Stärkung der Stromkennzeichung auf europäischer Ebene
Freiburg, August 2015
Stellungnahme von „EnergieVision“ zum „CEER Public Consultation Paper on Advice on ‘green’ electricity“.
Studie: Strom aus Erneuerbaren Energien schönt Klimabilanzierung
Saarbrücken, Mai 2014
Die gängigen Methoden zur Berücksichtigung von Strom in Klimabilanzen haben eine nur geringe ökologische Aussagekraft, daher spiegeln diese nicht das Ausmaß eines ökologischen Zusatznutzens von Strom aus erneuerbarer Erzeugung wider. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Saarbrücker Instituts für ZukunftsEnergieSysteme (IZES gGmbH), das im Auftrag von EnergieVision e.V. erstellt wurde.
Machbarkeitsuntersuchung der Bewertung von Lieferanten leitungsgebundener Energie in Bezug auf ihren Beitrag zur Energiewende („ EVU-Check“)
Bottrop und Freiburg, März 2014
Hintergrundpapier der Hochschule Ruhr-West und Büro Ö-quadrat im Auftrag von EnergieVision e.V.
Ökologische Bewertung von Ökogas-Produkten
Heidelberg, Dezember 2013
Hintergrundpapier des ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung im Auftrag des EnergieVision e.V.
Projektbericht: Weiterentwicklung des freiwilligen Ökostrommarktes
Hamburg, November 2013
Ein Projekt der HIC Hamburg Institut Consulting GmbH im Auftrag des EnergieVision e.V.
Rechtliche Möglichkeiten für eine gesetzliche Definition des Begriffs "Ökostrom"
Freiburg, 2013
Gutachertliche Äußerung erstellt durch Becker Büttner Held im Auftrag des EnergieVision e.V.
Vergaberechtliche Aspekte bei der Beschaffung von Ökostrom
Berlin, August 2013
Herausgegeben von Rechtsanwälte Bethge.Reimann.Stari